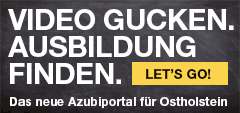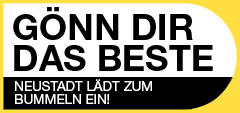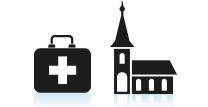Ein Blick in die Vergangenheit mit dem „Diarium Saxe“
Plön (los). Wiederholt hat der Plöner Historiker Prof. Detlev Kraack in dem Gutsarchiv von Nehmten der Familie Fürstenberg einen Schatz historischer Mitteilungen gehoben und ausgewertet. Herausgekommen ist das kommentierte Tagebuch „Das Diarium Saxe (1538 – 1616) – Alltagsnotizen aus Flensburg und Husum“. Im Plöner Kreismuseum wurde es druckfrisch vorgestellt. Erschienen ist „Das Diarium Saxe“ im Verlag Nordfriist Institut in 25821 Bredstedt (ISBN 978- 3-88007-454-5).
Detlev Kraack hat eine Kladde aus alter Zeit herausgegeben und kommentiert, die Einblicke in die Übergangszeit vom Spätmittelalter in die frühe Neuzeit ermöglicht. Das unscheinbare Heft befand sich im Nehmtener Gutsarchiv.
Inhaltlich ein spannendes Zeitfenster, lädt die Quellenedition „Das Diarium Saxe“ Leser zum Eintauchen in ein längst vergangenes Jahrhundert ein. Erläuterungen im Einleitungsteil erschließen zunächst die folgenden kommentierten Notizen. Ein breit ausgeführtes Personen-, Orts- und Sachregister schließt sich an. Historische Abbildungen und Aufnahmen ergänzen den Band.
Bei den Notizen handelt sich um persönliche Mitteilungen eines Kaufmanns, Peter Saxe (um 1508 – 1571) aus Hattstedt, das nördlich von Husum gelegen ist. Seine beruflichen Wege führten ihn nach Flensburg in einer Zeit, als die Reformation gerade durchgesetzt worden war.
Peters Sohn Jakob Saxe (1554 – 1616) wurde Geistlicher in Husum und führte das begonnene Notizheft seines Vaters fort. Zwischen den Zeilen, die meist in Niederdeutsch verfasst sind, aber auch mit Latein oder Griechisch jonglieren, hat Detlev Kraack ermittelt, was Vater und Sohn im täglichen Leben bewegt und beschäftigt hat.
Saxe, der 1538 nach Flensburg wanderte, wurde nicht nur erfolgreicher Kaufmann, sondern Ratsherr, Kirchengeschworener und Kämmerer, „einer der referiert, wofür er Geld ausgibt“, so Kraack. Zudem sei Saxe Führer der Bürgerwehr geworden, „zum Beispiel für die letzte Fehde 1569 gegen die Dithmarscher, mit moderner Artillerie und Feuerwaffen“. Abgesehen von solchen Mitteilungen, Gemüsebau und Garten fand Saxe aber auch Maßnahmen wie Aderlass und das Schneiden von Zehennägeln erwähnenswert. Die Pediküre erledigte ein „Bartscher“ - ein Bartscherer beziehungsweise Bader aus Schleswig.
Die Saxes sind gebildet: „Sämtliche Saxes studierten in Wittenberg“, berichtet Kraack aus dem Inhalt der Kladde. Namhafte Renaissance-Humanisten sind mit dem Ort Wittenberg verbunden, an dessen Universität Philipp Melanchthon (alias Schwarzerdt) lehrte (Altgriechisch). Er war ein enger Mitarbeiter Martin Luthers gewesen.
Peter Saxe schreibt von Geldangelegenheiten zur Unterstützung des studierenden Sohnes. Deutlich werde dabei das weite Netzwerk der Akteure.
Auch der geheimnisvolle Einband, der in Zweitverwertung das Originalheft umhüllt, passt da ganz gut ins Bild: Lateinische Verse von Vergil, durchgestrichen, teils abgegriffen und blass. „Ich tippe auf Schulgebrauch“, schätzt Detlev Kraack.
Und was tun im Konflikt mit Gottesdienst-Schwänzern? „Ein Druckmittel war, sie nicht in geweihter Erde zu bestatten“, so Kraack. Das Machtwort des Pastors Jakob Saxe scheint bei renitenten Zeitgenossen gewirkt zu haben.
Ungewöhnliche Wetterbeobachtungen und Auswirkungen auf die Erträge haben die Saxes festgehalten. War die Ernte wegen Dürre knapp – oder wegen eines nassen Sommers verdorben?
Natürlich haben familiäre Ereignisse ihren Platz in der Kladde. Da wird die zehnjährige Tochter Kathrine 1553 ins Preetzer Kloster geschickt, wo die Schule offenbar nach der Reformation fortgeführt wurde und auch für die Flensburger Kaufleute geöffnet war. „Sie ist über ein Jahr da, dann in Hamburg für ein Jahr im Beginen-Konvent“, führt Kraack aus. Zwei Jahre später heiratete das Mädchen.
Und wie behalf man sich bei schwächelnder Gesundheit? Ein Mittel gegen winterlichen Vitamin C Mangel etwa? Die Saxes kannten zwei Rezepte für einen Trank, den sie als „Potio contra Scorbutum“ bezeichnen. Abends und morgens werde die Medizin getrunken, teilt Jakob Saxe in diesem medizinischen Eintrag mit.
Jakob scheint 1616 im Gasthaus St. Jürgen in Husum verstorben zu sein, offenbar an einer Angina. Er befand sich im 63. Lebensjahr. Auch wenn das Durchschnittsalter der Menschen vielleicht niedriger war, erwähnt „Das Diarium Saxe“ auch Menschen, die damals mit rund 90 Jahren sehr alt gestorben sind und mit Gottes Segen beerdigt wurden.
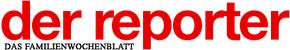


 Zurück
Zurück
 Nach oben
Nach oben